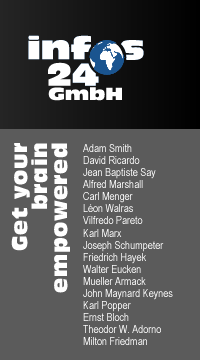eins | zwei | drei | vier
1. Klassik
2. Neoklassik
3. Karl Marx
4. Joseph Schumpeter
5. Ordoliberalismus
6. Keynesianismus
8. Philosophische Kritik
9. Monetarismus
Es ist ja bereits bekannt, dass es viele Dinge gibt, die die Leute in der Regel interessieren, zum Beispiel Biographien, wir aber nichts darüber berichten. Zum einen, weil es hierzu unendlich viele Websites gibt, wo darüber berichtet wird, zum anderen, weil wir es eigentlich auch für irrelevant halten.
Popper gehört nun eindeutig nicht zu den Ökonomen. Er ist, je nachdem wie man es sieht, ein Philosoph, ein Erkenntnistheoretiker, ein Soziologe oder ein Politologe. Wer also Philosophie, Soziologie oder Politologie studiert, stößt irgendwann auf den Namen Karl Popper. In den Wirtschaftswissenschaften taucht er sporadisch auf. Warum taucht er hier auf?
Zum einen taucht er auf, weil uns volkswirtschaftliche Themen in der Realität, also in der öffentlichen Debatte, nie in der Form begegnen, wie es in den Lehrbüchern steht. Wir beschreiben also mal die allgemeine Situation, die Lösung Poppers und die Schwachpunkte dieser Lösung.
In der Realität haben wir es mit einem diffusen Gelalle zu tun. Das tönt dann in etwa so.
"Die Union hat drei Wurzeln: eine liberale, eine konservative und eine christlich-soziale. Gerade die, für die das christliche Menschenbild Grundlage ihrer Politik ist, müssen sich um die Frage der Gerechtigkeit kümmern", findet Volker Kauder. Im Interview mit der Welt am Sonntag betonte der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagfraktion zugleich, dass die Union die richtigen Antworten auf die aktuellen Herausforderungen hat: "Wir werden die Menschen in den nächsten Monaten davon überzeugen, dass die Union das bessere Zukunftskonzept hat und dass Angela Merkel die Interessen Deutschlands und Europas am besten vertritt." |
"Der Markt reguliert sich am besten selbst" - "Wirtschaft bestimmt, was ein gerechter Lohn ist" - "Energieversorgung braucht keine Steuerung". Solche Glaubenssätze sind einfach. Aber funktionieren sie auch? Oder brauchen Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Energie verbindliche Spielregeln? Ist das nicht die Idee der Sozialen Marktwirtschaft? |
Wir bekämpfen die Ursachen der Arbeitslosigkeit, indem wir die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessern und auf eine wachstumsorientierte Beschäftigungspolitik setzen. Dazu stabilisieren wir den Euro, entlasten den Jobmotor Mittelstand, halten die Lohnnebenkosten stabil, reduzieren Steuern und Abgaben, bauen Bürokratie ab und geben mehr Geld für Bildung und Forschung aus. Mit Mini-Jobs, Zeitarbeit und Teilzeit sorgen wir für die nötige Flexibilität und schaffen einen Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt. Wir vertrauen den Arbeitnehmern und Arbeitgebern, weswegen wir die Tarifautonomie stärken. Löhne sollen von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden ausgehandelt und nicht vom Staat als gesetzlicher Mindestlohn vorgegeben werden. |
Das heißt, wir haben ein völlig sinnfreies Geblubbere. Die CDU hat drei Wurzeln, die liberale, die konservative und die christlich-soziale. Der Begriff liberal sagt nun gar nichts, siehe Walter Euchken, vor allem in der Variante Hayek ist er eher das, was der Autor mit "erzkonservativ" verbindet. Im Grunde ist der Ordoliberalismus und Liberalismus eine Randbemerkung zur Klassik. Christlich-sozial ist immer gut, aber was heißt das konkret?
Die SPD merkt dann an, dass sich der Markt wohl nicht immer selbst reguliert. Das ist sozusagen ein Misch aus liberal und sozial, konservativ sind sie also irgendwie nicht, aber irgendwie ist das das Gleiche wie das CDU Gebrabbel.
Die FDP verbessert dann die wirtschaflichen Rahmenbedingungen und ist für Wachstum, das ist auch keine schlechte Idee. Eine konkrete Wirtschaftspolitik lässt sich hieraus aber nicht ableiten.
Was bleibt? Parteien haben stark den Charakter eines Rorschachtest, das heißt die Wähler können in die Programme der Parteien mehr oder weniger das reinprojezieren, was ihnen Spaß macht. Bestenfalls geben Wahlen also das kollektiv Unbewusste verschiedener Bevölkerungsgruppen wieder. Da Programme im Grunde eh keine Rolle spielen, ist die öffentliche Debatte auf Personen fokusiert. Man traut also einzelnen Personen eher zu, ein Problem zu lösen, als einer rationalen Wirtschaftspolitik, die konkrete Ziele und Zwischenziele nennt, sowie die Parameter, mit denen der Zielerreichungsgrad gemessen werden kann.
Unter diesen Auspizien verliert natürlich das Fach Volkswirtschaftslehre jede Bedeutung. Wenn z.B. die neue Brille von uns Westerwelle die gleiche Bedeutung hat, wie die Frage, ob man via Riesterrente Konsum in die Zukunft verlagern kann, dann sollte man Julia Roberts zur Bundeskanzlerin wählen, die wäre wenigstens emotional eine Bereicherung.
Das ist auch ein Problem, mit dem die Piraten zu kämpfen haben. Deren zentrales Thema ist Transparenz. Transparenz, innerhalb eines demokratischen Entscheidungsprozesses, hat zwei Aspekte: Offenlegung der Fakten / Entscheidungsgrundlagen politischen Handelns seitens der Akteure und der Wille diese Informationen auch nachzufragen, sowie die Fähigkeit, diese zu bewerten. Wenn aber die Fokusierung auf Personen weit interessanter ist, als die Fakten und die Entscheidungsgrundlagen politischen Handelns, dann werden diese a) nicht nachgefragt, b) besteht die Fähigkeit nicht, diese zu bewerten.
Ein Tatbestand, der die Ökokaste nicht im mindestens stört, siehe Präliminarien. Diese sieht ihre Aufgabe in der Politikberatung, die ist sogar gesetzlich festgeschrieben, siehe Gesetz über die Bildung eines Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Dieser soll unabhängig sein, wird aber von der Regierung ernannt. Und ja, dieser Sachverständigenrat hat sogar eine eigene Website, Sachverständigenrat Wirtschaft. Es ist hierbei natürlich eine Bagatelle, aber letztlich symptomatisch für die Irrelevanz dieser Einrichtung.
§ 2 |
Naheliegenderweise interessiert das natürlich keine Sau. Denn wir lesen.
Der Streik der Gewerkschaft Unabhängige Flugbegleiter (UFO) gegen die Lufthansa AG unterstreicht abermals die Notwendigkeit, das Streikrecht besser gesetzlich zu regeln (...). Zumindest SOLLTE der Gesetzgeber dafür Sorge tragen, dass das Ultima-Ratio-Prinzip bei der Rechtssprechung deutlicher als bisher Anwendung findet. (....) Ein weiterer Vorschlag besteht darin, eine in den Vereinigten Staaten bestehende Regelung ins Blickfeld zu nehmen. Dort kann der Präsident der Vereinigten Staaten unter bestimmten Voraussetzungen eine Abkühlungsphase vor Arbeitskampfmaßnahmen verordnen. |
Sie tun also genau das Gegenteil von dem, was sie sollen.
Der eigentlich Witz an diesem Gesetz, also dem Gesetz über die Bildung eines Sachverständigenrates, ist aber ein anderer. Wem soll es konkret Erleuchtung bringen und wenn dieser jemand, wer immer das sein mag, dann erleuchtet ist, wie soll die Erleuchtung dann konkret umgesetzt werden? Offensichtlich reicht es, die Politiker zu erleuchten, die Plebs, die diese wählen soll, muss nicht erleuchtet werden, da, das scheint die Annahme, Wahlen ohnehin nicht auf rationalen Erwägungen beruhen.
Das Gesetz über die Bildung eines Sachverständigenrates wurde 1963 eingeführt. Das Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes, das Bürgern die Möglichkeit gibt, Behörden von Bund und Ländern mal Fakten aus dem Bauch zu kitzeln, 2005. Die Erkenntnis, dass Transparenz wichtiger ist als Beratung, dämmert also nur langsam.
Richtig reibungslos umgesetzt wird aber nur das erste. Beim zweiten ist man doch sehr bockig und widerwillig. Wobei teilweise schon schnell klar wird, worum es geht. Auf der Grundlage dieses Gesetzes wollte jemand von der Berliner Bildungsbehörde wissen, wie hoch die Abrecherquote bei Schülern ist, wie hoch der Anteil der Schüler, die eine Empfehlung für's Gymnasium erhält und die Notendurchschnitte: Berlins Schulen müssen ihre Daten offenlegen. Verweigert wurde die Herausgabe mit dem Argument, dass der Bürger mit nackten Zahlen nichts anfangen könne und dies nur zu Missverständnissen führe. Zu viel Transparenz ist also schädlich, wenn der Bürger zu blöd ist, die Fakten zu interpretieren. Über hochkomplexe zusammenhänge darf er aber alle paar Jahre, sogar im Bündel, abstimmen.
Diese geistige Haltung dürfte in Politik und Bürokratie weit verbreitet sein. Wer aber diese Ansicht vertritt, der vertritt auch die Ansicht, dass man auch würfeln anstatt wählen könnte. Kann eine Politik nicht rational bewertet werden, machen Wahlen keinen Sinn. Dass ausgerechnet eine BILDUNGSBEHÖRDE eine solche Meinung vertritt, ist ein Skandal.
Grauenhaft ist aber, dass ein ökonomischer Laie wie der Vorsitzende des deutschen Philologenverbandes, der es gerade mal zu einem Germanistikstudium geschafft hat, über den Zusammenhang zwischen Arbeitsmarkt und Anteil der Bevölkerung mit Abitur schwadroniert, siehe Zwischen Qualität und Quantität – Wird das Gymnasium zum Opfer des eigenen Erfolgs?.
Je größer der Akademikerarbeitsmarkt wird, desto weniger kann er sich den generellen Konjunkturzyklen und Wellenbewegungen des Arbeitsmarktes entziehen. Wenn heute angesichts eines Anteils von rund 25 Prozent Akademikern behauptet wird, dass deren Risiko, arbeitslos zu werden, gering ist, gilt dies bei einer Wirtschaftskrise und einem Anteil von über fünfzig Prozent mit Sicherheit nicht mehr in gleichem Maße. |
Er will uns also mitteilen, dass man Akademiker von strukturellen Anpassungsprozessen grundsätzlich auszunehmen sind. Der Mann vertritt Beamte, das merkt man.
Der brabbelt hier irgendwelche halbverstandenen Thesen nach. Kein Arbeitsmarkt kann sich, sowenig wie die Wirtschaft insgesamt, generellen Konjunkturzyklen entziehen. Vermutlich will er sagen, dass das Risiko arbeitslos zu werden für Akademiker geringer ist, wenn der Anteil an Akademikern künstlich knapp gehalten wird. Das trifft zwar zu, würde aber für jede Berufsgruppe zutreffen und das Angebot an Germanisten muss schon sehr knapp gehalten werden, damit diese sicher einen Job finden.
Das ist aber nicht mal das Verheerende an seinem dadaistischen Gestammel. Das Verheerende ist die Reduktion schulischer Bildung auf die Relevanz am Arbeitsmarkt, wobei eine gut ausgebildete Bevölkerung auf Krisen flexibler reagieren kann, als eine schlecht ausgebildete. Verheerend ist, dass der deutsche Philologenverband dummdreist seinen Dünkel pflegt und die Bedeutung der Bildung für den demokratischen Entscheidungsprozess nicht sieht.
Wer Bildung instrumentell definiert über die Eignung zur Durchsetzung von Zielen, hölt sie letztlich aus. Wenn schon der deutsche Philologenverband, also der Verband der Gymnasiallehrer, Bildung mit Ausbildung verwechselt, dann können wir ohne weiteres erahnen, was an deutschen Schulen so abgeht. Den Zustand beschreibt Popper weitgehend richtig.
Wir sind hier, wie ich glaube, bei einem einigermaßen bedeutsamen Resultat angelangt, das sich verallgemeinern läßt. Institutionen zur Auswahl der Vortrefflichkeit lassen sich wohl kaum entwerfen. Die institutionelle Auswahl mag zu brauchbaren Ergebnissen führen, wenn sie einem Zweck dient, wie ihn Platon vor Augen hatte, nämlich dem Anhalten der Veränderung. Aber sie wird niemals gut arbeiten, wenn wir von ihr mehr verlangen; sie wird immer die Tendenz haben, Initiative und Orginalität und, allgemein gesprochen, alle ungewöhnlichen und unerwarteten Qualitäten auszuschalten. Das ist keine Kritik des politischen Institutionalismus, sondern nur eine Wiederholung dessen, was bereits früher festgestellt wurde: Wir sollten uns immer auf die schlechtesten Führer vorbereiten, obwohl wir natürlich versuchen sollten, die besten zu bekommen. Es ist aber eine Kritik der Tendenz, die Institutionen, insbesondere die für die Erziehung geschaffenen Institutionen, mit der unmöglichen Aufgabe der Auswahl der besten zu belasten. Dies sollte nie ihre Aufgabe sein. Diese Tendenz macht unser Erziehungssystem zu einer Rennbahn und den Studiengang zu einem Hürdenrennen. Der Student wird nicht ermutigt, sich seinen Studien um des Studierens willen zu widmen, es wird ihm nicht wirkliche Liebe für seinen Gegenstand und für die Forschung eingeflößt; statt dessen treibt man ihn zum Studium um seiner persönlichen Karriere willen an; er wird angeleitet, sich nur so viel an Wissen anzueignen, als zur Bewältigung der Hürden, die ihm auf dem Weg zur Beförderung begegnen, unbedingt notwendig ist. Mit anderen Worten: Sogar auf dem Gebiet der Wissenschaft beruhen unsere Auswahlmethoden auf einem Appell an eine ziemlich grobe Form von persönlichem Ehrgeiz. |
Die Debatte um die Kompetenz des Wählers ist so alt, wie die Diskussion um die Regierungsformen. Die vermeintliche Inkompetenz des Wählers ist quer durch alle geschichtlichen Epochen, auch bei Plato, darauf kommen wir gleich zurück, wenn wir über Karl Poppers Werk, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, Band I, Der Zauber Platons, sprechen, zurück, das Hauptargument gegen die Demokratie.
Man kann einen systemischen Zusammenhang vermuten, wenn Massenmedien eher dazu neigen, die Kompetenz des Wählers in Frage zu stellen, als die Kompetenz der Politik und der Bürokratien. Massenmedien sehen ihre Aufgabe eher darin, das scheint auch der ökonomisch sinnvollere Weg zu sein, dem Bürger die Politik zu "erklären". Sie sehen ihre Aufgabe nicht darin, die Politik mit der Kompetenz des Bürgers anzureichern.
Die Diskussion wurde mit dem Aufkommen des Internet neu entfacht, es begann die Diskussion um die Schwarmintelligenz, was meist despektierlich gemeint war und ökonomisch interessiert. Braucht der Schwarm keinen großen Welterklärer mehr, dann wird der Journaille und den Verlagen die Existenzgrundlage entzogen. Es wird die Möglichkeit genommen, irrelevante Themen zu setzen und zu hypen. Zu dieser Kategorie gehört auch der despektierlich so titulierte Wutbürger. Hier wird also ein Verhalten, vor allem eben von der Journaille, die diesen Begriff gehyped hat, negativ bewertet, das aber tatsächlich den Kern der Demokratie darstellt. In der frühest Form der Demokratie, die wir kennen, die von Athen, meinte Perikles zu diesem Thema.
Wir vereinigen in uns die Sorge um unser Haus zugleich und unsere Stadt, und den verschiedenen Tätigkeiten zugewandt, ist doch auch in staatlichen Dingen keiner ohne Urteil. Denn einzig bei uns heißt einer, der daran gar keinen Teil nimmt, nicht ein stiller Bürger, sondern ein schlechter, und nur wir entscheiden in den Staatsgeschäften selber oder denken sie doch richtig durch. Denn wir sehen nicht im Wort eine Gefahr fürs Tun, wohl aber darin, sich nicht durch Reden zuerst zu belehren, ehe man zur nötigen Tat schreitet. |
Bei Perikles ist also der Bürger, der an den staatlichen Dingen keinen Anteil nimmt, schlicht ein schlechter Bürger.
Demokraten nennt man die Leute, die akzeptieren, dass sie abgewählt werden können. Das ist eine Minimaldefinition. Demokraten sollte man vor allem die Leute nennen, die sich konsequent, bezüglich des Bildungssystem, der Transparenz von Verwaltungen, der Nutzbarmachung der Kompetenz der Bürger, dafür einsetzen, dass eine rationale Wahl getroffen werden kann. Es ist durchaus vorstellbar, dass die repräsentive Demokratie vor allem den Nichtwähler repräsentiert und solange nicht alles unternommen wurde, damit eine rationale Wahlentscheidung möglich ist, erscheint die Diskussion über die Kompetenz des Wählers sehr philosophisch.
Die konkrete Umsetzung der Demokratie, vor allem wirtschaftliche Fragen, rücken bei Karl Popper, "Die offene Gesellschaft und ihre Feinde", etwas in den Hintergrund. Der erste Band analysiert die politschen Vorstellungen Platons, der zweite Band die Vorstellungen von Hegel und Marx. Alle drei sind die Feinde der offenen Gesellschaft. Grob läuft die Diskussion so. Wird von einer idealen Gesellschaft ausgegangen (Platon), bzw. wird davon ausgegangen, dass die Gesellschaft zwangläufig auf einen bestimmten Zustand zusteuert (Hegel, Marx) dann ist, naheliegenderweise, ein langsames Herantasten über trial und error via demokratische Entscheidungsprozesse entbehrlich und folgerichtig ist die Demokratie in dieser Vorstellungswelt überhaupt entbehrlich.
Abstrakter formuliert: Popper überträgt seinen erkenntnistheoretischen Ansatz auf soziale Prozesse. Der Ansatz an sich ist trivial und wird "intuitiv" überall realisiert. Eine Theorie kann im eigentlichen Sinne nicht bestätigt werden, die Möglichkeit, dass sie in Zukunft wiederlegt wird, besteht immer. Entscheidend ist aber, dass sie so formuliert wird, dass sie überhaupt mit der Realität in Konflikt geraten kann, also überhaupt falsifizierbar formuliert und gehaltvoll sein. Das kann aus unterschiedlichen Gründen nicht der Fall sein (wir fassen Popper jetzt mal ganz grob zusammen und entfernen uns da auch etwas vom Orginal).
1) Trivialitäten sind natürlich falsifizierbar formuliert, aber sind so trivial, dass sie nicht einmal falsch sein können. Das Pareto Gedöns, zum Beispiel, ist garantiert richtig. Es besagt, wenn es mal ganz kurz fasst, dass ein Tausch nur stattfindet, wenn sich beide Tauschpartner besser stellen (oder zumindest keiner schlerchter), siehe Vilfredo Pareto. Sieht man mal von den Fällen ab, dass einer der beiden nicht durchblickt, einer dem anderen einen Gefallen tun will oder der eine dem anderen schlicht die Rübe einschlägt und gar nicht tauscht sondern ihn ausraubt, dann stimmt das schlicht immer. Auch die weiteren Konsequenzen, an denen nun mal das Herz der Ökokaste hängt, dass die Wohlfahrt optimiert wird, wenn man alle tauschen lässt, stimmt dann natürlich auch. Theoretisch ist die These zwar falsifizierbar, man müsste nur zwei Leute finden, die, bei vollem Bewußtsein und ohne Anwendung von Gewalt, tauschen, obwohl sie, oder einer davon, nach dem Tausch unglücklicher sind als vorher, und die These wäre widerlegt. Wir können aber davon ausgehen, dass das selbst bei den Marsmenschen nicht der Fall ist, es sei denn, die Marsmenschen sind Masochisten. (Wobei eigentlich die These auch dann stimmt. Sie maximieren ihre Wohlfahrt, indem sie ihr Unglück steigern.) Ein Spezialfall hiervon ist dann eine Aussage, bei der schlicht jedes Ereignis mit der Realität übereinstimmt. Eine Aussage vom Typ "wenn der Preis fällt, dann sinkt, steigt die Nachfrage oder bleibt gleich" ist zwar falsifizierbar formuliert, aber diese Aussage wird immer bestätigt, denn es gibt schlicht keine reale Situation, die mit dieser Aussage nicht in Einklang steht. |
Sieht man die Sache mit dem gesunden Menschenverstand, wird man an gehaltvolle Thesen den Anspruch stellen, dass sie sowohl falsifizierbar formuliert wie auch gehaltvoll sein müssen. Desgleichen wird einem der gesunde Menschenverstand auch zahlreiche Beispiele liefern, wo das Kriterium der Falsifizierbarkeit eben nicht sinnvoll ist.
Nicht sinnvoll ist das Kriterium Falsifizierbarkeit dann, wenn das, was empirisch untersucht werden soll, selber das Ergebnis von etwas ist. Um diese Frage dreht sich der Positivismusstreit zwischen Adorno (oder der Frankfurter Schule im Allgemeinen) und Popper. Man könnte z.B. die These aufstellen, dass eine ökonomisch ungleiche Entwicklung innerhalb der EU die Stereotypenbildung fördert. Diese These liese sich sogar, schaut man durch den internationalen Blätterwald und durch die Foren der verschiedenen Zeitungen, ohne weiteres beweisen. Allerdings haben wir es hier weniger mit einer zwangsläufigen Entwicklung zu tun, als mit dem Umstand, wie diese Konflikte in den Massenmedien dargestellt werden. Ein ökonomisch korrekte Sichtweise, die sich auch vermitteln ließe, ergäbe einen differenzierteren Meinungsbildungsprozess und die Bildung bzw. das Wiedererstarken von Stereotypen würde unterbleiben. Anders formuliert: Die Aussage bezieht sich auf das Ergebnisses eines Prozesses. Demnach wäre die Aussage, dass Stereotypen nach wie vor vorherrschen zwar richtig und ist auch falsifizierbar formuliert, aber trotzdem von geringer Aussagekraft, weil von dem Prozess, der das Ergebenis hervorgebracht hat, abstrahiert wird.
Demokratie sieht Popper nun, in Analogie zum Experiment in den Naturwissenschaften, als eine Möglichkeit, Thesen zu falsifizieren. Wird eine bestimmte wirtschaftspolitische Maßnahme durch eine demokratisch gewählte Regierung umgesetzt, dann kann diese Maßnahme durch eine Abwahl eben dieser Regierung auch wieder rückgängig gemacht bzw. modifiziert werden.
Damit ändert sich natürlich auch die Fragestellung. Die Frage, die jahrhundertelang im Fokus stand, die Frage nämlich, WER regieren soll, ist zweitrangig. Entscheidend ist die Frage, wie man eine schlechte Regierung wieder los wird und hier ist die Demokratie das einzige Verfahren, das hierauf eine klare Antwort hat.
Weiter warnt Popper vor der Vorstellung, quasi auf dem Reißbrett die ideale Gesellschaftsordnung konzipieren zu wollen, bzw. vor der Vorstellung, dass die Geschichte unerbittlich auf einen klar definierten Endzustand zusteuert und man lediglich "Geburtshilfe" leisten könne.
Diese Vorstellung, dass man einen sich ohnehin vollziehenden Prozess lediglich beschleunigen kann, prägte die DDR, siehe Karl Marx. So kommt es dann zu dem dubiosen Geschwurbel in Artikel 9 der Verfassung der DDR: "Sie [also die Volkswirtschaft der DDR] entwickelt sich gemäß den ökonomischen Gesetzen des Sozialismus auf der Grundlage der sozialistischen Produktionsverhältnisse und der zielstrebigen Verwirklichung der sozialistischen ökonomischen Integration." Da entwickelt sich also etwas gesetzesmäßig nach den Gesetzen des Sozialismus und man kann den ohnehin unausweichlich stattfindenden Prozess nur beschleunigen. Zum selben Ergebnis kommt man, wenn man die ideale Gesellschaftsform irgendwo in der Vergangenheit ansiedelt, wie dies Platon tut. Dann will man lediglich, genaus so radikal, zurück zu einer idyllisch vorgestellten Gesellschaft.
Popper plädiert, ausgehend von einer marktwirtschaftlichen Ordnung, für eine Politik der kleinen Schritte, die jeweils demokratisch kontrolliert werden. Die Vorstellung einer ideellen Gesellschaft, sei es, dass diese sich als zwangläufiges Resultat einer historischen Entwicklung ergibt (Hegel, Marx), sei es, dass diese in der Vergangenheit lokalisiert wird, macht die Demokratie entbehrlich. Wer im Besitz der Wahrheit ist, braucht eine Demokratie sowenig, wie der Naturwissenschaftler, der von der Gültigkeit eines Naturgesetzes überzeugt ist, sich veranlasst sieht, dessen Gültigkeit experimentell zu überprüfen.
Im Gegensatz zu dem, was man hier und da liest, sieht der Autor aber einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen den Liberalen vom Typ Hayek, Friedman, Eucken und dem Liberalismus Poppers. Liberale vom Typ Hayek, Friedmann und Eucken argumentieren systemisch (auch wenn Hayek mit seinem "Anmassung von Wissen" Geplauder das Gegenteil behauptet). Dieser konservative Liberalismus (Hayek, Friedman, Eucken) geht systemisch vor. Im Grunde haben sie eine klare Vorstellung der idealen Wirtschaftsordnung und wenn diese nicht umgesetzt wird, dann kann man auf die Demokratie ruhig verzichten, was Hayek und Friedman durch ihre Unterstützung der Pinochet Diktatur ja auch ausführlich dokumentiert haben, siehe Warnung vor der Planwirtschaft. Speziell Milton Friedman hält wenig von Demokratie, siehe Milton Friedman on Democracy. Die Logik dahinter ist simpel. Was es regeln gibt, regelt der Markt und was der Markt nicht regelt, muss auch nicht geregelt werden. Am Reißbrett entworfen ist auch der Ordoliberalismus von Eucken.
Ein weiterer Unterschied ergibt sich in der Analyse totalitärer Systeme. Für Hayek und Eucken sind es "sozialistische" Bewegungen aller Art, die letztlich, indem sie ökonomische Ressourcen an sich ziehen, alle Bereiche des Staates durchdringen. Hayek dreht an dieser Stelle völlig frei. Prinzipiell alle sozialistischen Strömungen, das Buch "Wege zur Knechtschaft" widmet er den Sozialilisten in allen Parteien, subsumiert er unter die Großgruppe kollektivistisch. Eucken argumentiert im Grunde ähnlich, verschweigt aber den Nationalsozialismus.
Popper sieht in jedem Versuch eine ideale Gesellschaft am Reißbrett zu zeichnen und dann umzusetzen einen Weg in den totalitären Staat. Allerdings richtet sich zumindest der erste Band, das ist den Andeutungen zu entnehmen, gegen den Nationalsozialismus. Die Gliederung der Gesellschaft nach Rassen, die Erziehung einer bestimmten Schicht zur Führung, die Reduktion von Bildung auf die Vermittlung einer Staatsdoktrin, die ständische Gliederung der Gesellschaft, die Erziehung der Jugend durch den Staat und nicht durch die Eltern charakterisieren den Nationalsozialismus mehr als den Kommunismus stalinistischer Prägung. Ob uns das hilft, totalitäre Systeme tatsächlich zu begreifen, siehe die offene Gesellschaft und ihre Feinde, es ist ein weiterer Theorieansatz innerhalb sehr vieler Theorieansätze, mag dahingestellt sein, auf jeden Fall unterscheidet sich der Liberalismus von Karl Popper deutlich von dem Liberalismus eines Hayek.
Zwar hat Hayek, jenseits dessen, was allgemein akzeptiert wird, also die Steuerung der Wirtschaft über den Preis, kaum konkrete Vorstellungen über Details einer Wirtschaftsordnung, aber diese unpräzisen Vorstellungen will er im Zweifelsfalle wenigstens durch einen Diktator durchgesetzt sehen.
Popper wendet sich lediglich gegen jede Vorstellung eines "idealen" Zustandes und vor allem gegen die Versuche, diesen "idealen" Zustand gewaltsam durchzusetzen. Was bei Hayek im Grunde eine Phrase ist, die "Anmassung von Wissen", ist bei Popper Programm. Der Spruch von der "Anmassung des Wissens" wird dann zur Leerformel, wenn keine Methode vorgestellt wird, wie eine These falsifiziert werden kann. Bei Popper haben wir ein klares Kriterium. Während Hayek den Diktatur vorzieht, wenn sich Demokraten Wissen anmaßen, ist bei Popper die Demokratie die condition sine qua non der Möglichkeit, eine These zu falsifizieren.
Der beliebte Spruch von der "Anmassung des Wissens" ist eine Leerformel, weil man damit jede Vorstellung diskreditieren kann. Wir brauchen aber keine allgemeine Formel zur Diskreditierung jeder Vorstellung, wir brauchen ein Verfahren, mit dem festgestellt werden kann, dass eine bestimmte Vorstellung unzutreffend ist.
Hayek, Eucken und Friedman waren Ökonomen, Popper nicht. Ökonomen neigen zu einer systemischen Sichtweise. Sie suchen nach einer Ordnung, nach Parametern, die ein bestimmtes Verhalten erzwingen, bzw. ein bestimmtes Verhalten als wahrscheinlich erscheinen lassen. Was die Wirtschaft angeht, trifft das ja auch teilweise zu, andernfalls hätten wir kein Muster, sie würde völlig chaotisch ablaufen und wäre politisch, außer durch Zwangsmaßnahmen, nicht steuerbar.
Im Gegenzug haben wir aber schon x Mal gesehen, dass es kaum wirtschaftliche Parameter gibt, die nicht lediglich Ausdruck eines außerwirtschaftlichen Zusammenhanges sind. Noch die allertrivalste Kurve, die zum Beispiel, die den Zusammenhang zwischen Beschäftigung und Output anzeigt, beinhaltet außerökonomische Zusammenhänge: Bildungsniveau, Innovationskraft, Wissen um Organisationen, Risikobereitschaft etc. und der Autor wird das Gefühl nicht los, dass diese außerökonomischen Faktoren für die wirtschaftliche Entwicklung bedeutsamer sind, als die ökonomischen Faktoren im engeren Sinne. Dies wäre dann gleichbedeutend mit der Aussage, dass die Wirtschaft nur sehr bedingt überhaupt steuerbar ist, was ja für einen Ökonomen keine interessante Perspektive darstellt.
Was also von Léon Walras, Carl Menger so energisch bestritten wird, ist leider die Realität. Die Wirtschaft ist eingebettet in eine komplexere Gesamtstruktur und jeder systemische Erklärungsansatz ist ein am Reißbrett entworfenes Modell. Die schlichte Ignorierung des politischen Umfeldes hängt mit dem Selbsverständnis der Volkswirtschaftslehre zusammen. Wer ewig gültige Gesetze gefunden hat, sieht keine Veranlassung, deren Gültigkeit auch tatsächlich über einen demokratischen Entscheidungsprozess überprüfen zu lassen.
Das in der Volkswirtschaft herrschende systemische Denken vom Typ "... in Spanien waren die Zinsen niedrig, dies wiederum hat die Bautätigkeit angeregt.." mag im Einzelfall sogar zu einer richtigen Situationsbeschreibung führen, geht aber über den homo oeconomicus weit hinaus. Der homo oeconomicus ist ein rational kontrolliertes Konstrukt. Seine Maximierung des Wohlstandes maximiert den Wohlstand der Gesamtbevölkerung. Eine Aussage vom oben gemachten Typ, praktische jede volkswirtschaftliche Studie arbeitet so, beschreibt die Wirkung der Veränderung eines Parameters auf das Verhalten, hat aber eine ganz andere Qualität. Hier wird der Mensch zur Marionette. Selbst wenn im Einzelfall der Zusammenhang zutrifft, ist er keineswegs zwangsläufig. Die spanische Regierung zum Beispiel hätte die Möglichkeit gehabt, die Ressourcen dahin zu lenken, wo die Effekte nachhaltiger gewesen wären, bzw. sie hätte vor der Krise warnen können. Das systemische Vorgehen der Volkswirtschaftslehre ist teilweise der Grund, warum sich Menschen systemisch verhalten. Es gibt auch die Möglichkeit aufzuklären und die scheinbar systemischen Zusammenhänge zu durchbrechen. Das wiederum scheint aber dem grundsätzlichen Anspruch der akademischen Volkswirtschaftslehre zu widersprechen.
Glaubt man nicht an die ewig gültigen Gesetze, ist man auf die Kompetenz, das Verantwortungsgefühl und die moralische Integrität der Einzelnen angewiesen. Folgerichtig lesen wir bei Popper.
Die meisten von ihnen [die Kritiker der Demokratie] sind mit den demokratischen Institutionen unzufrieden, weil diese keine Garantie dafür bieten, dass die Staatspolitik den wichtigsten moralischen Maßstäben (wenn schon nicht den höchsten) auch nur einigermaßen gerecht wird. Aber diese Kritiker richten ihren Angriff aufs falsche Ziel; sie verstehen nicht, was man von demokratischen Institutionen erwarten kann, und sie wissen nicht, wie die Alternative zu demokratischen Institutionen aussehen würde. Die Demokratie [...] schafft den institutionellen Rahmen zur Reform politischer Institutionen. Sie ermöglicht die gewaltlose Reform von Institutionen und damit den Gebrauch der Vernunft beim Entwurf neuer Institutionen sowie bei der Verbesserung der alten. Sie kann nicht die Vernunft selbst herstellen. Die Frage des intellektuellen und moralischen Standards ihrer Bürger ist in weitem Maße ein Problem von Personen. (Es ist meiner Meinung nach ein Irrtum, wenn man glaubt, dass sich dieses Problem durch eine institutionelle Eugenik und eine Kontrolle der Erziehung anpacken lässt;[...]). Es ist völlig falsch, wenn man die Demokratie für die politischen Unzulänglichkeiten eines demokratischen Staates verantwortlich macht. Wir sollten eher uns, das heißt die Bürger des demokratischen Staates, zur Verantwortung ziehen. In einem nichtdemokratischen Staat führt der einzige Weg zu vernünftigen Reformen über den gewaltätigen Sturz der Regierung und die Errichtung eines demokratischen Rahmens. Die Kritiker der Demokratie, die sich irgendwelcher "moralischen" Gründe bedienen, haben es versäumt, zwischen persönlichen und institutionellen Problemen zu unterscheiden. Es ist unsere Aufgabe, die Verhältnisse zu verbessern. Die demokratischen Institutionen können sich nicht selbst verbessern. Das Problem ihrer Verbesserung ist stets ein Problem, das Personen und nicht Institutionen betrifft. Wenn wir aber Verbesserungen durchzuführen wünschen, dann müssen wir klarmachen, welche Institutionen wir verbessern möchten. |
Die Demokratie ist also bei Popper keine systemisch funktionierende Veranstaltung. Es reicht also nicht, ein paar Parameter umzuschalten, damit der Apparat wieder stotterfrei funktioniert. Es hängt tatsächlich von der Qualifikation, dem Engagements und der moralischen Integrität der Bürger ab, wie die Institutionen eingerichtet werden und welche eingerichtet werden. Die Vernunft steckt nicht im System, sie steckt in den Bürgern. Die Demokratie setzt lediglich einen Rahmen, in dem die Vernunft walten und schalten kann, die Vernunft jedoch steckt in den Bürgern. Oder eben auch nicht. Das Thema hatten wir schon, siehe Präliminarien.
Die Demokratie ist ein Suchprozess. Das systemische Denken schlägt leicht um in eine Weltanschauung bei der kein Bedarf an Vernunft besteht, weil das Optimum bereits gefunden ist. Graduelle Unterschiede sind leicht wahrnehmbar. Wer aber im Besitz der Wahrheit ist, sieht keine Veranlassung, seine Hypothesen zu hinterfragen. Hayek ist näher an Karl Marx, als er dies selbst vermutet, nicht nur praktisch, wie seine Bewunderung für Pinochet bezeugt, siehe Warnung vor der Planwirtschaft, sondern auch theoretisch.
Die heutige Mode, die Demokratie als den bedrohten Eckpfeiler unserer Zivilisation hinzustellen, hat ihre Gefahren. Sie ist weitgehend für den irreführenden und unbegründeten Glauben verantwortlich, dass keine Willkürherrschaft möglich ist, solange der Wille der Mayorität für die Ausübung der Macht ist. Die trügerische Sicherheit in die sich viele Leute durch diesen Glauben wiegen lassen, ist eine Hauptursache der allgemeinen Sorglosigkeit gegenüber den uns drohenden Gefahren. Der Glaube, dass keine Regierung eine Willkürherrschaft sein kann, wenn sie nur ein Produkt des demokratischen Wahlverfahrens ist, ist ganz unbegründet und die darin liegende Gegebüberstellung vollkommen falsch: Nicht der Ursprung, sondern die Begrenzung der Regierungsgewalt bewahrt sie vor Willkür. Es ist möglich, dass das demokratische Kontrollrecht eine Willkürherrschaft verhindert, aber dann nicht durch seine bloße Existenz. Wenn die Demokratie sich zu einer Aufgabe entschließt, die notwendigerweise einer Anwendung der Staatsgewalt voraussetzt, die sich nicht an festen Normen orientieren kann, muss sie zur Willkürherrschaft werden. |
Wenn er von der MODE spricht, die die Demokratie als den bedrohten Eckpfeiler der Demokratie hinstellt, dann ist er nicht mehr weit entfernt von Pareto, für den die Demokratie eine Religion ist, siehe Vilfredo Pareto, Soziologie. Pareto wiederum ist für Popper ein Vordenker des Totalitarismus.
Hayek geht also davon aus, dass demokratische Entscheidungsprozesse auch zu einer Willkürherrschaft führen können. Das ist schlicht falsch. Solange die Demokratie nicht außer Kraft gesetzt wird, kann die Willkürherrschaft auch wieder abgewählt werden. Das Phänomen, dass demokratische Wahlen zu einer Regierung führen, die die Demokratie abwählen, ist richtig, wir erleben das aktuell in Ägypten, wir schreiben immer noch das Jahre 2013. Dann ist es aber eben keine Demokratie mehr. Was Hayek sagen will, ist, dass demokratische Entscheidungsprozesse zu einer Wirtschaftspolitik führen, die ihm nicht gefällt. Anzumerken ist jedoch, dass seine Wirtschaftspolitik dem bedeutendsten Ökonom aller Zeiten, nämlich Keynes, nicht gefällt. Es ist unter diesen Auspizien schon reichlich tollkühn, seine Vorstellungen als ultimative Wahrheit hinzustellen, die nicht mehr durch einen demokratischen Entscheidungsprozess hinterfragt werden kann.
Das Argument, dass das Buch "Der Weg zur Knechtschaft" 1944 zum ersten Mal veröffentlicht wurde und insofern ein Kind seiner Zeit war, sticht nicht wirklich. Seiner Bewunderung für Pinochet brachte er noch 1981 zum Ausdruck, siehe Warnung vor der Planwirtschaft.
Die festen Normen, an die sich die Demokratie halten muss, sind die Vorstellungen Hayeks. Sind dieses nicht verwirklicht, ist eine Diktatur, die diese Vorstellungen verwirklicht, besser. So stellt Hayek sich das vor.
Hayek hat den eigentlichen Witz nicht verstanden. Die Demokratie führt allerhöchstens für einen gewissen Zeitraum zur Willkürherrschaft. Wird über einen demokratischen Prozess die Demokratie selber ausgehebelt, dann braucht man sich über Rechtsstaatlichkeit, Begrenzung der Regierungsgewalt, Legitimität eines demokratischen Herrschaft etc. auch keine Gedanken mehr machen. Die werden dann allesamt gleich mitausgehebelt.
Der eigentliche Fehler Hayeks steckt aber tiefer und er zieht sich durch die gesamte Volkswirtschaftslehre. Der Fehler ist die systemische Denke bei gleichzeitiger Reduktion der Komplexität. Die Reduktion der Komplexität, das heißt die Modellierung anhand von Parametern, die lediglich Ausdruck eines Sachverhaltes sind, nicht aber die Ursache, ist die Bedingung für diese Vereinfachung. Die vermeintliche Stärke der Volkswirtschaft, die Möglichkeit, "allgemein" gültige Gesetze zu entwickeln, wird mit Trivialität erkauft. Ein Gesetz, das von den individuellen Umständen abstrahiert, ist immer gültig und damit wertlos. Die Reduktion auf rein wirtschaftliche Zusammenhänge, die es de facto gar nicht gibt, macht des weiteren den Weg frei zum Glauben an ein vermeintliches Expertenwissen, das der demokratischen Kontrolle so wenig unterliegen muss, wie die Forschung im Bereich der Molekularbiologie. Das ist letztlich der Grund, warum die Volkswirtschaft auch gar nicht nach einem Transmissionsmechanismus zur Durchsetzung ihrer Vorstellungen in einem demokratischen Entscheidungsprozess sucht, siehe Präliminarien.
Allerdings kann die Volkswirtschaft eher als der Chemiker, Physiker, Molekularbiologe etc. das "Große und Ganze" in den Blick nehmen. Sie ist eher in der Lage, systemische Fehler in der Gesamtwirtschaft zu erkennen.
Den Vorwurf der systemischen Denke kann man teilweise auch Keynes machen. Das Streben nach Sicherheit, letztlich der Grund, warum der Geldmarkt dominiert, kann in einem gewissen Umfang dadurch verhindert werden, dass der Staat oder die Staaten Informationen zur Verfügung stellen. Das Vertrauen, dass Kapitalsammelstellen Kapital optimal allozieren, muss man nicht teilen. Unsicherheit ist Ausdruck mangelnden Wissens. Kann man diesen Mangel beseitigen, schwindet auch die Unsicherheit.
Eine Möglichkeit dies zu tun wäre ein totale Umstrukturierung der VWL Studiengänge. Wir brauchen weniger verbeamtete Schwätzer, die beraten wollen, als Leute, die tatsächlich auch was können und sich auch in komplexe praktische Probleme, auch technischer Natur, einarbeiten können.
Das heißt, dass auch das keynessche System Sachverhalte als gegeben hypostasiert, die lediglich Ausdruck von etwas sind, wobei vorstellbar ist, dass dieses etwas geändert werden kann. Die angedachte Finanztransaktionssteuer ist so betrachtet auch keine optimale Lösung. Optimal wäre eine Lösung, die es Kapitalsammelstellen ermöglicht, Kapital optimal zu allozieren anstatt es an der Börse hin- und her zuschieben. Im übrigen, gibt es für Spekulationen eine viel einfachere Lösung. Die Zentralbanken sollen die Kreditvergabe an konkrete Bedingungen knüpfen. Geld gibt es für Realinvestitionen und nicht für das Füttern von Blasen.
Die Frage ist also ganz schlicht die: Wenn niemand im Besitz des absoluten Wissens ist, wer soll dann entscheiden? Wenn wir davon ausgehen, dass 82 Millionen Deutsche mehr wissen, als 640 Parlamentarier, und davon können wir ausgehen, dann kann es nur noch um die Frage gehen, wie wir das Wissen der Öffentlichkeit einfließen lassen in demokratische Entscheidungsprozesse und die elementarste Grundbedingung hierfür ist die Möglichkeit, Erkenntnisfortschritte auch durchzusetzen, das heißt Regierungen wieder abwählen zu können.
Bis hierhin rennt Popper allerdings, zumindest in der "westlichen Welt", offene Türen ein. Fundamentaldiskussionen dieses Typs kann man höchsten in Gesellschaften führen, wo der Bildungsstand sehr niedrig ist, also zum Beispiel in Bezug auf Afghanistan. Ob die westliche Unterstützung für die Mudjahedin in Afghanistan eine brilliante Idee war, kann man kontrovers diskutieren. Zumindest ein Großteil der weiblichen Bevölkerung empfanden die sowjetische Besatzung als Befreiung und ein Großteil der Probleme, die dann folgten, hätte man gar nicht gehabt, wenn eine starke Zentralregierung Minimalstandards in Bezug auf Menschenrechte und Versorgung durchgesetzt hätte. Afghanistan ist aber wirklich ein extremer Fall.
Einer der bedeutsendsten Intellektuellen Südamerikas, Mario Vargas Llosa, teilt im Übrigen auch die Ansicht Hayeks nicht, dass es in Südamerika, außer eben dem demoktratisch gewählten Salvador Allende, nach Hayek ein Diktator, keine Diktatur gegeben habe.
Lo importante es que ese modelo, que por fin está echando raíces en nuestros países, no se nos deteriore, se nos degrade, y retrocedamos una vez más en la historia hacia la dictadura, hacia el populismo; es decir, hacia esas instituciones que son la razón misma de nuestro subdesarrollo y nuestro atraso. |
Das Entscheidende ist, dass dieses Modell [die Demokratie], das nun allmählich in unseren Ländern Wurzeln schlägt, nicht in Misskredit gebracht wird, nicht beschädigt wird und wir wieder einmal einen geschichtlichen Rückschritt zur Diktatur machen, zum Populismus. Zu jenen Institutionen also, die der eigentliche Grund unserer Unterentwicklung und unserer Rückschrittlichkeit sind. http://www.larepublica.pe/20-03-2012/mario-vargas-llosa-hay-que-defender-nuestras-democracias |
Zwischen "Links" und "Rechts", zwischen Fidel Castro, Pinochet, Vidal macht Mario Vargas Llosa da keinen Unterschied. Vielleicht hätte Hayek und Friedman sich mal vorher sachkundig beraten lassen. Das Gastspiel Mario Vargas Llosa bei der Friedrich Naumann Stiftung wiederum war wohl ein Dialog zwischen Tauben, siehe Gerhardt gratuliert Mario Vargas Llosa. Hätte Mario Vargas Llosa gewusst, dass Gerhardt den größten Fan von Pinochet feiert, hätte er ihm wahrscheinlich nicht mal die Hand gereicht. Im Jahre 2006 äußert sich Mario Vargas Llosa in El PAÍS folgendermaßen.
No hay modelo pinochetista. Un país no necesita pasar por una dictadura para modernizarse y alcanzar el bienestar. Las reformas de una dictadura tienen siempre un precio en atrocidades y unas secuelas éticas y cívicas que son infinitamente más costosas que el statu quo. Porque no hay verdadero progreso sin libertad y legalidad y sin un respaldo claro para las reformas de una opinión pública convencida de que los sacrificios que ellas exigen son necesarios si se quiere salir del estancamiento y despegar. La falta de ese convencimiento y la pasiva resistencia de la población a los tímidos, o torpes, intentos de modernización explican el fracaso de los llamados “gobiernos neoliberales” a lo largo y ancho de América latina, y fenómenos como el del tonitronante comandante Chávez, en Venezuela. |
Es gibt kein Modell Pinochet. Ein Land braucht, um sich zu modernisieren und einen gewissen Wohlstand zu erreichen keinen Diktator. Die Reformen einer Diktatur gehen immer einher mit Terror und ethischen und zivilen Folgeerscheinungen, die schlimmer sind als der status quo. Denn einen wirklichen Fortschritt ohne Freiheit und Rechtstaatlichkeit gibt es nicht ohne die Unterstützung der Reformen durch die öffentliche Meinung, die davon überzeugt ist, dass diese Opfer nötig sind, wenn man sich von der Stagnation lösen und sich entwickeln will. Der Mangel an dieser Überzeugung und der passive Widerstand der Bevölkerung gegen die vorsichtigen und tolpatischen Versuche der Moderniesierung erlären das Scheitern der sogenannten "neoliberalen Regierungen" überall in Südamerika und Phänomene wie die des donnernden Kommandanten Chavez in Venezuela. http://www.lanacion.com.ar/871352-las-exequias-de-un-tirano |
Daraus können wir dann entnehmen, dass die Welt komplizierter ist und ein allgemeines Freiheitsgeschwafel, das im Zweifelsfalle auch von Diktaturen umgesetzt werden kann, niemanden irgendwie weiter bringt. Wir lernen auch, dass man die 46 Millionen Euro die man in die Friedrich Naumann Stiftung steckt, besser in den Bau und die Unterhaltung von Schulen investieren würde. Demokratien scheitern öfter an mangelnder Bildung und Ausbildung als an einer falschen Wirtschaftspolitik.
In Südamerika haben wir sozusagen die systemische Denke in vivo beobachten können. Anstatt die Politik zu "beraten" hätte man besser versucht, die Bevölkerung zu überzeugen, was ja, aus den verschiedensten Gründen, die Ökokaste nicht als ihre Aufgabe erachtet. Die Chicago Boys sahen es als ihre Aufgabe Pinochet zu überzeugen. Die nicht Überzeugten hat man einfach in den Knast gesteckt oder zu Tote gefoltert.
Zumindest in der westlichen Welt hat sich Popper durchgesetzt, unabhängig davon, ob jemand den Namen schon mal gehört oder nicht und ob irgendjemand mal ein Buch von ihm gelesen hat oder nicht. Wir robben uns vorsichtig voran und wir haben ein Mischsystem. Die Zeit der Fundamentaldiskussionen neigt sich dem Ende zu.
Im Übrigen sieht Hayek die Sache etwas einseitig. Wir können ihn so verstehen, dass er Demokratie als die Diktatur der Mehrheit ansieht. Ein zwar reichlich theoretisches Konstrukt, zumindest in der Verfassungswirklichkeit der "westlichen" Staaten, aber möglich. Genauso grob könnte man aber auch umgekehrt argumentieren. In einer Demokratie ist es kaum möglich, dass eine Minderheit ihre Interessen zu Lasten der Mehrheit durchsetzt und dieses Phänomen ist historisch leichter beobachtbar und die größere Gefahr.
Letzteres ist im Übrigen auch in einer Demokratie möglich, wenn die Mehrheit gar nicht weiß, dass sie die Zeche bezahlt. Es dürfte z.B. relativ wenigen Leuten bekannt sein, dass auf alle Speichermedien eine ZPÜ (Zentralstelle für private Überspielungsrechte) Gebühr erhoben wird. Argumentiert wird, dass man auf CD, DVD, Sticks etc. urheberrechtliches Material kopieren könnte, für das die Urheber dann, über ein weitgehend intransparentes Verfahren vergütet werden sollen. Weder ist klar, wie diese Gebühren tatsächlich erhoben werden, noch wie die Einnahmen verteilt werden.
Die übliche Hayek Suada singt auch dieser Artikel in der Welt. Es ist die übliche Suada von der Plebs, die man besser über gar nichts entscheiden lässt. Da "Die Welt" ein Produkt der Springer Presse ist, können wir nachvollziehen, dass die Springer Presse ihre Klientel im Blick hat.
"Demokratie" heißt einfach nur, dass gewählt wird und die Mehrheit entscheidet – auch wenn es sich bei jener Mehrheit um einen Haufen abergläubischer Bauern mit Fackeln und Mistgabeln handelt. |
Da die Springer Presse ja für die Mehrheit schreibt, ist ihre Klientel also ein Haufen abergläubischer Bauern mit Fackeln und Mistgabeln. Na wenn die Springer Presse das so sieht, dann wird es wohl stimmen.
Die Wahrheit dürfte wesentlich einfacher sein. Solange der Arbeitsaufwand für den Bürger, der sich in ein Thema einarbeiten will, enorm hoch ist, wird er das im Zweifelsfalle unterlassen, bzw. sich nur dann damit beschäftigen, wenn er unmittelbar davon betroffen ist. Traut er sich des weiteren nicht zu, seine Sicht der Dinge wirkungsvoll öffentlich darzustellen, wird er allen möglich Unsinn hinnehmen. Er wird also, aus Mangel an Zeit und Geld sogar hinnehmen, dass Laien über Dinge entscheiden.
Nach diesem Schema kann also die Demokratie nur die Fehler korrigieren, die viele Leute betreffen, denn nur diese Fehler haben das Potential, in den Fokus der öffentlichen Diskussion zu geraten, wobei selbst das nicht sicher ist. Welches Thema relevant ist und welches nicht, entscheidet letztlich die Politik und die Journaille. Beide werden die Themen pushen, wo sie meinen punkten zu können bzw. wo sie meinen die Auflage steigern zu können. So können dann auf einmal Themen auftauchen, etwa die "Integration" von "Ausländern" (die sollen sich in irgendwas integrieren, wobei unklar ist, in was eigentlich; soll der homosexuelle Deutsche türkischer Abstammung sich jetzt bei der Aids Hilfe in Kreuzberg engagieren, dem Katholizismus beitreten, Atheist werden oder sich den in Berlin so verhassten schwäbischen Akzent abgewöhnen?), die zehn Jahre lang kein Thema waren. Diese Themen werden dann zwei Wochen gehyped, um anschließend wieder zu verschwinden, ohne dass irgendein Erkenntnisfortschritt erzielt worden wäre.
Je komplizierter ein Thema wird, desto stärker wird es personalisiert und desto stärker wird es auch emotionalisiert. Wer sich im Moment, wir schreiben immer noch das Jahr 2013 und nach wie vor haben wir Finanzkrise, Schuldenkrise, Bankenkrise, Eurokrise, die spanische, französische, italienische und englische Presse durchliest, der könnte meinen eine Zeitreise 150 Jahre zurück gemacht zu haben. In Spanien sind die Deutschen die Betonköpfe, die Europa unterjochen wollen, in Deutschland sind die "Südländer" Halodris, die das Geld zum Fenster rauswerfen, die Franzosen finden, dass die Deutschen zu effizient sind und die Deutschen finden, dass die Franzosen den Deutschen den Euro aufgedrückt haben. Also wild alles durcheinander. (Wer eine austarierte Sicht sehen will, findet diese hier Prof.Dr. Flassbeck: Die Eurokrise. Warum die Ökonomen die Krise nicht verstehen. Das ist übrigens mal eine seltene Ausnahme. Das ist ein Volkswirt und kein Vertreter der Ökokaste. Man muss ihm nicht in jedem Punkt zustimmen, aber er redet ganz unverquast Tacheles.)
Je intransparenter ein Vorgang ist, desto eher wird man auf uralte Stereotypen rekurrieren, die den Vorgang erklären. Viel mehr bleibt ja auch nicht übrig. Das wiederum wird dann den Gruppen Munition liefern, die der Meinung sind, dass man die Plebs über wichtige und komplizierte Fragen nicht abstimmen lassen darf, wobei man verschweigt, dass man den Vorgang genau so wenig durchschaut, aber die Deutungshoheit karrierefördernd ist.
Der Vorgang ist jetzt ausgesprochen skurril. Wir haben ja Debatten unterschiedlichster Art. Wir haben die Theorien von Anthony Down, der sagt, dass Parteien ein Programm zusammenstellen, das die Mehrheit gut findet, wir haben Friedrich Hayek, der sieht in der Demokratie die skruppelosen Sozialisten schalten und walten, wir haben die Riesengruppe derjenigen, wie etwa Walter Eucken, der sich mit so Kleinigkeiten, wie seine Ideen überhaupt konkret politisch durchsetzbar werden können, schlicht gar nicht beschäftigt. Dann haben wir noch so abgedrehte Spinner wie Vilfredo Pareto, für die die Demokratie schlicht eine Ersatzreligion ist. Des weiteren sind noch Leute wie Platon im Angebot, wo besser eine Elite regiert, am besten Philosophen.
Eine Frage allerdings wird schlicht nie, seit nunmehr 2500 Jahren, diskutiert, obwohl diese Frage eigentlich die allernaherliegendste ist. Wie schafft man es, dass über die relevanten Fragen überhaupt rational abgestimmt werden kann, das heißt ein Meinungsbildungsprozess überhaupt möglich ist? Wie kommt man an die Fakten und wie kommt man an das Wissen, das man braucht, um die Fakten zu bewerten? Was Popper sagt, ist unstrittig richtig, aber man kann ihm nicht vorwerfen, sich in Details zu verlieren, was man in diesem konkreten Fall aber tun könnte. Siehe auch Präliminarien.
Fasst man mal den ganzen Quark von Hayek, über Eucken und Anthony Downs bis hinab zu Pareto zusammen, dann geht es um diese schlichte Frage: Ist die Plebs zu blöd für Demokratie? Die Frage allerdings ist ziemlich theoretisch, denn da wo Transparenz herrscht, im einfachsten Fall über den Preis, ist sie in der Lage die Leute durchzufüttern, die sich solche weitreichenden Gedanken machen.
Die Diskussion um die Entscheidungsfähigkeit der Mehrheit ist in etwa so sinnvoll, wie die Frage, ob Menschen ein Betriebssystem verstehen. Lässt sich ein Betriebssystem nur über kryptische Linux Befehle steuern, sind es wenige, die damit umgehen können. Lässt es sich über die Maus steuern, sind es 100 Prozent der Menschheit, wenn man mal von Kleinkindern absieht. Bill Gates hätte hier also die Alternative zwischen klagen und Problem lösen gehabt. Ersteres hätte nicht geholfen, zweiteres hat im zum multi-multi Milliardär gemacht.
Die Debatte um Transparenz wird durch zwei Entwicklungen verschärft. Zum einen durch die Schaffung einer Megabürokratie wie der EU, die so intransparent ist, dass sie sich faktisch jeder Kontrolle entzieht. Zum anderen durch das Internet, das die Nachfrage nach Informationen erhöht hat, weil es zum einen durch plastische Beispiele gezeigt hat, was man alles Interessantes wissen könnte und zweitens zeigt, wie Informationen aufbereitet werden können. Das Internet zeigt seine Leistungsfähigkeit allein schon durch die schiere Masse an Informationen, die problemlos gefunden werden können. Die Journaille kämpft hier auf verlorenem Posten. Siehe das Internet und die Volkswirtschaftslehre.
Des weiteren hatten wir im Verlaufe dieses Lehrbuches schon unendlich viele Beispiele für Initiativen, die diese notwendige Transparenz erzwingen werden.
Die Qualität einer Demokratie hängt, genauso wie die Wirtschaft, vom Bildungsstand der Bevölkerung ab. Je besser dieser ist, desto schärfer und präziser wird die öffentliche Debatte und je schärfer und präziser die öffentliche Debatte, desto hochwertiger sind die Antworten auf politische Fragen. Der Bildungsstand ist also neben der Transparenz die zweite entscheidende Variable.
Wenn aber der deutsche Philologenverband tatsächlich die Gymnasiallehrer vertritt, dann haben wir hier auf jeden Fall eine Baustelle. Nach eigenen Angaben des deutschen Philologenverband hat dieser 90000 Mitglieder, das wäre die Hälfte aller Gymnasiallehrer. Wie die Jungs und Mädels zum Abitur gekommen sind, ist schleierhaft. Wenn der Autor Deutschlehrer wäre und so ein Geschwurbel als Abitursaufsatz vorgesetzt bekäme, dann würden die Fetzen fliegen, das wäre das Ende seiner Großmut und seines Humors. Die Zahlen stammen vom Autor.
(1) Der DPhV setzt sich für ein begabungsgerechtes, gegliedertes Schulwesen unter dem Prinzip des Förderns und Forderns ein. Die Förderung von Hochbegabten ist ihm dabei genauso wichtig wie die von Schülerinnen und Schüler aus anderen Herkunftsländern, die in Deutschland eine neue Heimat gefunden haben. (2) Der DPhV steht für ein qualifiziertes, fortschrittliches Gymnasium mit Bildung und Erziehung im Mittelpunkt. Dabei kommt es ihm besonders darauf an, die Schülerinnen und Schüler auf die Herausforderungen unserer modernen Welt mit ihren wechselnden Strukturen vorzubereiten. Deshalb befürwortet er eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung der Lehrkräfte auf der Basis eines handlungs- und werteorientierten Berufsethos.(3) Die Personalausstattung, die Besoldung, das Ansehen und die damit verbundene Anerkennung der von den Lehrkräften erbrachten Leistungen sind weitere zentrale Anliegen der Verbandsarbeit. aus: http://www.dphv.de/ |
(1) In dem Adjektiv "begabungsgerecht" steckt die Annahme, im Fall dieser Truppe sogar in einer besonders konservativen Variante, denn sie plädieren für die Beibehaltung des dreigliedrigen Schulsystems, dass der Anteil, der für das Gymnasium "Begabten" eine geschichtlich stabile Konstante ist. Andernfalls macht das dreigliedrige Schulsystem ja logisch keinen Sinn. Ändert sich das Begabungsprofil der Gesellschaft so, dass alle für's Gymnasium geeignet sind, läuft sich das dreigliedrige Schulsystem irgendwann tot (was ja auch tatsächlich passiert). Wir erleben seit Jahrzenten, dass der Anteil der Abiturienten ständig steigt. Der Häuptling der Philologen erklärt sich das damit, dass das Niveau des Abiturs seit Jahren sinkt. Das Problem bei seiner These ist, dass die Anforderungen in Studim und Beruf seit Jahrzehnten ansteigen. Das lässt nur zwei Schlüsse zu. Entweder ist das Niveau des Abiturs nicht gesunken oder das Abitur hat keine Aussagekraft. Bei beiden Varianten muss man zu dem Schluss kommen, dass der Anteil der Abiturienten weiter zu erhöhen ist. Kinder mit Migrationshintergrund könnte man im Übrigen tatsächlich fördern. Zum Beispiel schlicht durch die Tatsache, dass man die jeweiligen Muttersprache als zweite Fremdsprache akzeptiert, deren Kenntnis von einer externen Stelle, z.B. einer Uni, geprüft wird.
(2) Das mit den Adjektiven ist schwierig, besonders für Philologen. Ein qualifiziertes Gymnasium ist ein Gymnasium, das qualifiziert ist. Das ein Gymnasium für irgendwas qualifiziert ist, ist zu hoffen. Aber für was? Dass es der Philologenverband für erwähnenswert hält, dass in einem Gymnasium die Bildung im Mittelpunkt steht, ist schon beunruhigend. Die "wissenschaftliche" Ausbildung der Lehrer allerdings ist ein Problem. Die "Wissenschaftlichkeit" ist eben das Problem des Philologiestudiums. Wer sich zu ausgiebig mit Altfranzösisch und dem Chanson de Roland beschäftigt hat, wird eben in der Schule Schiffbruch erleiden. Ohne überzeugende didaktische Ansätze, wie wir sie z.B. auf der www.franzoesisch-lehrbuch.de vorstellen, werden nicht nur einzelne Schüler und nicht nur einzelne Klassen, sondern ganze Klassenzüge Französisch zum frühest möglichen Zeitpunkt abwählen. Das ist nämlich das, was konkret passiert. Schüler für eine Sprache zu begeistern, hat mit Wissenschaftlichkeit nichts, aber rein gar nichts zu tun. Der handlungs- und werteorientierte Berufsethos ist nun maximales Blubberniveau und bedeutet konkret schlicht gar nichts. Wie Beamte ohne Berufserfahrung mit einem berauschenden Lebenslauf von Penne => Uni => Penne => Grab auf die moderne Welt vorbereiten wollen, ist ein Rätsel. Vor allem das mit den wechselnden Strukturen ist schwierig. So was kennt ein Beamter gar nicht und ihn davor zu schützen, ist, nach Meinung eines Beamten, die heiligste Aufgabe des Staates.
(3) Das Ansehen des Lehrerberufs kann auch leiden, wenn dessen Lobbytruppe Aussagen macht über das Begabungsprofil der Bevölkerung, die sich mit den objektiven Tatsachen nicht decken und die lediglich den Zweck haben, die eigenen Interessen durchzusetzen. In diesem Fall geht es konkret darum, mit dem Argument der höheren "wissenschaftlichen" Qualifikation eine höhere, im Vergleich zu Lehrern an anderen Schultypen, Besoldung durchzusetzen. Überzeugender wären Vorschläge oder zumindest eine Reflexion über andere didaktische Methoden. Wenn bildungsferne Schichten, also Philologen, die als Beamte dem Innovationsdruck der freien Wirtschaft gar nicht ausgesetzt sind und diesem in der Regel auch nicht gewachsen sind, die Leistungsfähigkeit des Frontalunterrichts preisen, kann das auch daran liegen, dass sie selber wenig Erfahrung mit der Aneignung von Wissen haben.
Besonders gravierend ist aber, dass der Zusammenhang zwischen Bildung und Demokratie überhaupt nicht reflektiert wird. Da kann man schon zweifeln, ob die Leerkörper vom DHPV "auf die Herausforderungen unserer modernen Welt mit ihren wechselnden Strukturen" vorbereiten können.
nach oben ...


Popper übrträgt seine Vorstellung, dass Thesen falsifizierbar formuliert werden müssen auf die Demokratie. Demokratie wird dann zu einem Erkenntnisprozess durch trial and error.
Nicht die Frage wer regiert ist entscheidend, sondern die Frage, wie man einen Regierenden wieder los wird.
Das impliziert jede Absage an den Versuch, eine "ideell" vorgestellte Gesellschaft planmäßig zu verwirklichen, worunter auch jede als ideell gedachte systemische Lösung fällt.
Die Vorstellungen Poppers können nur verwirklicht werden, wenn demokratischen Wahlen rationale Entscheidungen zugrunde liegen.